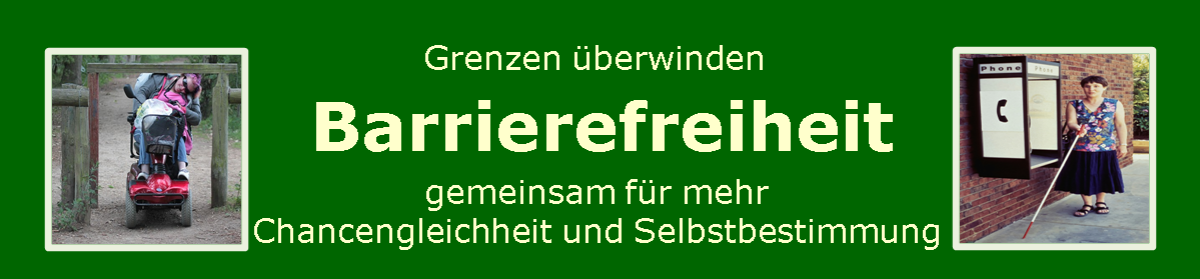Die zunehmende Benutzung der Gehwege durch den Radverkehr führt nicht selten zur Häufung von Konfliktsituationen zwischen Rad- und Fußgängerverkehr. Viel zu viele sichere Fußwege haben sich schon zu abenteuerlichen Parkour-Strecken verwandelt. Dies hat zur Folge, dass sich insbesondere ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen in zunehmendem Maß unsicher auf Gehwegen fühlen. Daraus resultiert aus Sicherheitsgründen letztlich die berechtigte Forderung der Fußgänger: Sichere Fußwege – Der Fußweg gehört dem Fußgänger!

Photo by sabrinamockphotography on Pixabay
Viele Radler setzen schon längst nicht mehr auf die konventionellen Fahrräder, bei denen allein die Muskelkraft zählt. Hier hat die Weiterentwicklung der Fahrräder zum Einzug von E-Rädern geführt. Sicher bringen sie für den Radler gewisse Vorteile. Aber diesen stehen auch zu bedenkende Nachteile gegenüber. Daher wollen wir auf dieser Seite in die Betrachtung der Konflikte zwischen dem Fußgänger – und Radverkehr sowohl konventionelle als auch E-Räder einbeziehen.
💡 Eine wesentliche Rolle bei der Verkehrssicherheit spielt natürlich ebenfalls das Verhalten und die gegenseitige Rücksichtnahme von Fußgängern und Radfahrern.
Dieses Thema haben wir ausführlich und tiefgehend auf unserer Seite „Verhaltensgründe von Fußgängern und Radfahrern, die sichere Fußwege verhindern“ für Sie erläutert.
Inhalt des Artikels
- 1 Was versteht man unter einem Fuß- oder Gehweg?
- 2 Was versteht man unter einem Radweg?
- 3 Rechtsrahmen – StVO
- 4 Verlagerung des Radverkehrs auf den Fußweg und dessen Konsequenzen
- 5 Gehen von Elektrorädern erhöhte Gefahren aus?
- 6 Verkehrssicherheit
- 7 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf höhnniveaugleichen Verkehrsflächen für den Rad- und Fußgängerverkehr
Was versteht man unter einem Fuß- oder Gehweg?
Was versteht man unter einem Radweg?
Radwege sind Bestandteil einer Radverkehrsanlage (Anlage des fließenden Radverkehrs). Die Kennzeichnung der Radwege erfolgt durch die Zeichen 237, 240 und 241 gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO).
Rechtsrahmen – StVO
Rechtliche Vorgaben über die Möglichkeit zur Benutzung von Fuß- und Radwegen bzw. die Benutzungspflicht von Radwegen durch Radfahrer sind im § 2 der Straßenverordnung (StVO) zu finden.
Wortlaut des § 2 Abs. 4 der StVO
Im § 2 „Straßenbenutzung durch Fahrzeuge“ Abs. 4 der StVO 1 Fassung aufgrund der Vierundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.04.2020 (BGBl. I S. 814), in Kraft getreten am 28.04.2020 heißt es:
„(4) Mit Fahrrädern darf nebeneinander gefahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird; anderenfalls muss einzeln hintereinander gefahren werden. Eine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist. Rechte Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen benutzt werden. Linke Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen nur benutzt werden, wenn dies durch das allein stehende Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ angezeigt ist. Wer mit dem Rad fährt, darf ferner rechte Seitenstreifen benutzen, wenn keine Radwege vorhanden sind und zu Fuß Gehende nicht behindert werden. Außerhalb geschlossener Ortschaften darf man mit Mofas und E-Bikes Radwege benutzen.“
Anmerkungen zu § 2 Abs. 4 der StVO
Wortlaut des § 2 Abs. 5 der StVO
Im § 2 „Straßenbenutzung durch Fahrzeuge“ Abs. 5 der StVO 2 Fassung aufgrund der Vierundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.04.2020 (BGBl. I S. 814), in Kraft getreten am 28.04.2020 heißt es:
„(5) Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden,
so dürfen abweichend von Satz 1 Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch diesen Radweg benutzen. Soweit ein Kind bis zum vollendeten achten Lebensjahr von einer geeigneten Aufsichtsperson
begleitet wird, darf diese Aufsichtsperson für die Dauer der Begleitung den Gehweg ebenfalls mit dem Fahrrad benutzen; eine Aufsichtsperson ist insbesondere geeignet, wenn diese mindestens 16 Jahre alt ist. Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen. Der Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Soweit erforderlich, muss die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden. Wird vor dem Überqueren einer Fahrbahn ein Gehweg benutzt, müssen die Kinder und die diese begleitende Aufsichtsperson absteigen.“
Anmerkungen zu § 2 Abs. 5 der StVO
Bis zum Inkrafttreten der Ersten Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 30. November 2016 galt, dass Kinder bis zur Vollendung ihres achten Lebensjahres Fußwege benutzen mussten, und Kinder bis zur Vollendung ihres zehnten Lebensjahres Fußwege benutzen durften. Diese Regelung galt allerdings nicht für die begleitende Aufsichtsperson. Sie musste die Begleitung auf der Straße vornehmen. Hierzu wurde ausgeführt, dass dadurch der Sichtkontakt und die Kommunikation von der Aufsichtsperson zum Kind häufig eingeschränkt ist, was die Aufsicht erschwert.
💡 Nach der neuen Regelung dürfen auf Fußwegen Radfahrende Kinder bis zu acht Jahren von Aufsichtspersonen auf dem Rad begleitet werden. Dadurch soll sich die Sicherheit für die Radfahrenden Kinder auf dem Fußweg erhöhen.
a) die oben genannten Altersgrenzen für die auf Fußwegen Radfahrenden Kinder wurden nicht geändert; Nach den Maßgaben des Bundesrates sind für die Anordnung von benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen wie a) außerörtliche Radverkehrsanlagen sowie keine Nachweise, für eine 30 %g höheren Gefahr im Vergleich zu anderen Straßen, mehr erforderlich.
b) die Aufsichtsperson muss mindestens 16 Jahre alt sein;
c) weiterhin besteht die Verpflichtung, dass Radfahrende Kinder und Aufsichtspersonen auf Fußwegen gegenüber den Fußgängern eine besondere Rücksichtnahme gewähren müssen;
d) entsprechend § 24 StVO ist die Fortbewegung auf den Fußweg mit besonderen Fortbewegungsmitteln, wie beispielsweise Schiebe- und Greifreifenrollstühlen, den Fußgängern gleichgestellt;
b) die Anordnung von benutzungspflichtigen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn
💡 Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr dürfen nunmehr auch baulich angelegte Radwege benutzen. Die zwingende Verpflichtung zur Nutzung der Gehwege besteht für sie nicht mehr.
Verkehrszeichen für den Fußgänger- und Radverkehr

Mit dem Zeichen 239 gemäß StVO werden für Fußgänger sogenannte „Sonderwege“ gekennzeichnet. Diese dürfen nur von Fußgängern, mit Ausnahme von Kindern bis zu 10 Jahren, genutzt werden. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer besteht ein Nutzungsverbot.
💡 Gekennzeichnete Wege mit Zeichen 239 müssen von Fußgängern genutzt werden.

Photo by H_m_n-b__ng on Pixabay
Sind Gehwege und Fußgängerzonen, wie mit Zeichen 239 (siehe Bild 3 oben) und 242 (siehe Bild 4 unten), und dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ gekennzeichnet, ist es statthaft diese Fußgängerbereiche mit dem Rad zu befahren. Es besteht hier jedoch keine Benutzungspflicht. Entscheidet man sich als Radfahrer diese Fußgängerbereiche zu nutzen, steht man in der Pflicht sich dort in Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h) fortzubewegen.

© Mobilfuchs
Entsprechend der Rechtsprechung haben in Fußgängerzonen und auf Gehwegen Fußgänger uneingeschränkten Vorrang. Sie dürfen durch den Radverkehr weder gefährdet noch behindert werden.

Photo by StudioTAO on Pixabay
Häufig werden straßenbegleitende Radwege, auch als Bordsteinradweg bezeichnet, mit Zeichen 237 (siehe Bild 5 oben) gekennzeichnet. Damit besteht für diese eine Benutzungspflicht, auch dann, wenn Sie der Auffassung sind, dass es sich auf der Straße besser fahren lässt.
In zunehmendem Maß wird von der Möglichkeit der Anlage von Fahrradstreifen am rechten Fahrbahnrand Gebrauch gemacht. Bei diesem handelt es sich um Sonderwege die mit Zeichen 237 gekennzeichnet sein können und für diese eine entsprechende Benutzungspflicht besteht.

Photo by EM80 on Pixabay
Bei Ausschilderungen von Wegen mit Zeichen 240 (siehe Bild 6 oben) besteht für Radfahrer eine Benutzungspflicht. Auf diesen Wegen existiert für Radfahrer gegenüber Fußgängern kein vorrangiges Nutzungsrecht. Allerdings sind die Fußgänger angehalten den Radfahrern die Möglichkeit zur Durchfahrt einzuräumen. Dies bedeutet, ein rechtzeitiges Klingeln und warten bis die Fußgänger dem Weg zu Durchfahrt freigeben. Insbesondere bei älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen kann es hier zu spürbaren Verzögerungen kommen, welchen gegebenenfalls auch durch das Anhalten Rechnung zu tragen ist.

Verlaufen Geh- und Radwege unmittelbar auf gleichen Höhenniveau nebeneinander, wird dies gemäß der StVO mit Zeichen 241 (siehe Bild 7 oben) gekennzeichnet. In diesen Fällen ist dem Radfahrer ein Ausweichen auf dem Gehweg nicht gestattet. Dabei gibt es auch keine Ausnahme für das Überholen.
In der Regel gilt die Benutzungspflicht für die Fahrtrichtung des Radverkehrs, die durch ein Verkehrszeichen ausgewiesen ist.
Für baulich eingerichtete Wege kann jedoch für den Radverkehr mit den Zeichen 237, 240 oder 241 in Verbindung mit dem Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ auch eine Nutzung in Gegenrichtung angeordnet werden.
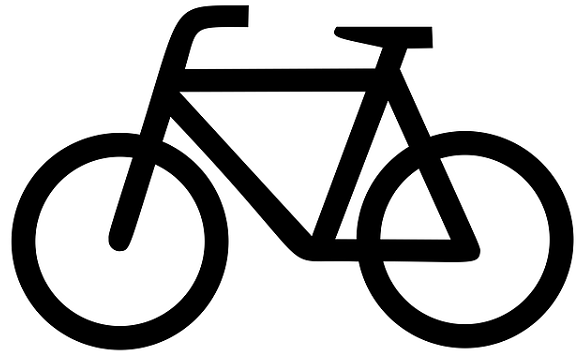
Nicht für alle Radwege besteht eine Benutzungspflicht (siehe Bild 8 oben). Diese Radwege sind nicht mit einem Verkehrsschild versehen. In der Regel sind diese unmittelbar an einem höhenniveaugleichen Gehweg angeordnet. Auf sie wird entweder durch eine andere Farbpflasterung (in Rot) oder durch ein auf dem Boden aufgebrachtes weißes Fahrradsymbol hingewiesen.
Bei den Zeichen 237, 239, 240, 241 und 242, gemäß § 41 StVO, handelt es sich um Vorschriftszeichen. Kommt es in der Folge einer Missachtung dieser Zeichen zu Gefährdungen oder Unfällen, kann ein Bußgeld fällig werden. Im Bußgeldkatalog sind diese der Gruppe 5 zugeordnet, die auf Sonderwege hinweisen.
Verlagerung des Radverkehrs auf den Fußweg und dessen Konsequenzen
Diese schwerwiegende Schlussfolgerung wurde nicht an den Haaren herbeigezogen. Eine Verkehrsbefragung unter Behinderten und älteren Menschen in den neuen Bundesländern im Rahmen des „Systems repräsentativer Verkehrsbefragungen (StV-Plus)“3Schriftenreihe „Barrierefreies Planen und Bauen im Freistaat Sachsen, Heft Nr. 1, Planungsgrundlagen für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes 1997 kommt zum gleichen Ergebnis.
Betrachtet man die Verhältnisse auf den Fußwegen einige Jahre nach der Gesetzeseinführung, so muss festgestellt werden, dass sich die Situation in Bezug auf die Sicherheit weder für den Radfahrer noch für den Fußgänger verbessert hat. Die neuen Möglichkeiten für Radverkehrs-anlagen werden noch viel zu selten eingesetzt.
Gehen von Elektrorädern erhöhte Gefahren aus?
Für Pedelec-Fahrer wurden die meisten kritischen Situationen auf dem straßenbegleitenden getrennten Rad- und Gehweg beobachtet.
💡 Der Verunglückte ist bei Unfällen mit Personenschäden, die unter Beteiligung von E-Rädern geschehen, in 21 % der Fälle nicht der Fahrer selbst, jedoch ein anderer beteiligter Verkehrsteilnehmer. Dagegen liegt bei bisher konventionell, mit Muskelkraft betriebenen Fahrrädern dieser Wert lediglich nur bei 5 %.
💡 Weiterführende Literatur: 💡 Als Grundlage für die Verkehrssicherheit des Rad- und Fußgängerverkehrs muss eine Verkehrsraumanalyse dienen, die im Interesse aller Verkehrsteilnehmer liegt. Sie sollte dazu beitragen, dass Unfälle, die auf eine mangelhafte Planung von Geh- und Radwegen zurückzuführen sind, vermieden werden können.Verkehrssicherheit
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf höhnniveaugleichen Verkehrsflächen für den Rad- und Fußgängerverkehr
Im Rahmen einer gleichberechtigten Teilnahme am Straßenverkehr ist es ebenso berechtigt und wichtig, für den Radverkehr eine selbständige sichere Verkehrsfläche zu schaffen. Das Netz gebauter Radwege ist zu vervollständigen. Aber auch alternative Lösungen für den Radverkehr sind entsprechen der örtlichen Gegebenheiten zu realisieren. Eine Lösung, auch aus Kostengründen, könnte die Möglichkeit der Anlage von Radfahrstreifen am rechten Fahrbahnrand sein.
Was ist ein Trennstreifen und welche Anforderungen muss er erfüllen?
Zu den höheniveaugleichen Verkehrsflächen – ohne einen wahrzunehmenden Bordstein – können u. a. zählen: a) Fahrbahnen für den Kraftverkehr,
b) Busspuren,
c) Radwege,
d) getrennte Fuß- und Radwege (Beschilderung mit Zeichen 241 StVO), und
e) Gleiskörper.
Trennstreifen müssen sowohl mit den Blindenlangstock als auch mit den Füßen taktil gut erkennbar sein. Ihr Farb- bzw. Hell-/Dunkelkontrast (von mindestens 0,4 gemäß DIN 32975 und DIN 32984) sowie die Oberflächenstruktur der Trennstreifen muss sich von den angrenzenden Bodenbelägen unmissverständlich abheben (vgl. Bild 9 unten).

© Mobilfuchs
💡 Die alleinige visuelle Gestaltung eines Trennstreifens ist nicht ausreichend, da dies von blinden Verkehrsteilnehmern mit Blindenlangstock und Füßen nicht wahrnehmbar ist (vgl. Bild 10 unten)!

© Mobilfuchs
Trennstreifen müssen über eine Mindestbreite von 30 cm verfügen. Empfehlenswert ist jedoch eine vorzugsweise Breite von 50 cm.
Bei einer ausreichenden Flächenverfügbarkeit sollte jedoch die Breite des Trennstreifens 60 cm betragen. Die Trennstreifenbreite ist der lichten Breite des Gehweges zu zuordnen.
Der Verlauf eines Trennstreifens sollte in einem Abstand von mindestens 60 cm von einem Leitstreifen erfolgen.
Für die Gestaltung von Trennstreifen können u. a. verwendet werden: a) Grünstreifen,
b) Profilsteine,
c) Kleinpflaster oder auch
d) speziell zur Gestaltung von Trennstreifen hergestellte Steine, welche den Anforderungen des jeweils aktuellen Stands der Technik entsprechen.
Die zum Einbau gelangenden Baumaterialien müssen so angeordnet werden, dass sich der Trennstreifen taktil gut von seiner Umgebung unterscheiden lässt. Hierzu sind glatte und grobe Oberflächenstrukturen notwendig. Mit Hilfe von auffälligen Fugen verlegte Pflastersteine, können grobe Strukturen geschaffen werden. Bei einer Kleinpflasterverlegung wird empfohlen, die Fugen mit einer Tiefe von 3 mm bis 5 mm sowie einer Breite von 10 mm bis 15 mm auszuführen. Glatte Oberflächen lassen sich mit Asphalt oder durch die engfugige Verlegung von großflächigen und ungefassten Platten herstellen.
Für die Gestaltung von Trennstreifen dürfen keine Bodenindikatoren verwendet werden.
Eine alleinige optische Gestaltung eines Trennstreifens ist nicht ausreichend. Eine ausreichende visuelle sowie taktile Wahrnehmung von Trennstreifen ist sicher zu stellen.
Mit Hilfe von Muldenstrukturen oder Aufwölbungen kann die Wahrnehmung von Trennstreifen eine deutliche Verbesserung erfahren.
Für die Begrifflichkeit „Trennstreifen“ wird auch gelegentlich der Begriff „Begrenzungsstreifen“ verwendet. Entsprechend der DIN 32984 wird der Trennstreifen den „sonstigen Leitelementen“ zu gerechnet. Für dessen Gestaltung sind keine Bodenindikatoren (mit Rippen- und Noppenstrukturen) zu verwenden.
In folgenden Regelwerken wird auf die Anlage von Trennstreifen verwiesen: a) Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – RASt
b) Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – ERA
c) Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen – HBVA, 2011
d) DIN 32984:2011-10
e) DIN 18040-3:2014-12
Es ist zu beobachten, dass die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben durch die StVO zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit für den Rad- und Fußgängerverkehr allein nicht ausreichen. Auch deren verstärkte Auslegung und den sich bietenden Anwendungsmöglichkeiten führen zu einer zunehmenden Verlagerung des Radverkehrs in die Fußgängerbereiche. Die gemeinsame Führung des Rad- und Fußgängerverkehrs auf einer gemeinsamen Verkehrsfläche, in der Regel dem Fußweg, stellt für beide Gruppen eine erhöhte Gefährdung dar. Diese Feststellungen werden durch die Ergebnisse durchgeführter Forschungsprojekte gestützt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Verkehrsministerkonferenz die Bundesregierung auffordert, auch verstärkt Maßnahmen zur Sicherheit für den Fußgängerverkehr zu ergreifen. Zur Erhöhung der Sicherheit sowohl für den Rad- als auch für den Fußgängerverkehr sind beide Verkehrsteilnehmergruppen zu trennen. Es ist ihnen jeweils eine separate und sichere Verkehrsfläche zu zuweisen.
Weiterführende Links:
- Die neue Freiheit durch Mobilitätshilfen mit Motorantrieb
- Die Mobilitätshilfe baut für Sie die goldene Brücke vom Traum zum erreichbaren Ziel
- Hinweise zum Antrag zur Kostenübernahme für Mobilitätshilfen
- Abstellanlagen für Elektrokleinstfahrzeuge
- „Grünpfeil“ oder „Grüner Pfeil“? – Die „Grünpfeil-Regelung“
- Signale im Fahrgasteinstiegsbereich von Eisenbahnfahrzeugen
- Poller im Straßenraum – bieten Sicherheit und können doch gefährlich sein
- Hintergrundaspekte und Verhaltensweisen von Fußgängern und Radfahrern, die sichere Fußwege verhindern
- Wo bitte ist die Ampel? – Barrierefreie Ampeln im Straßenverkehr
- Wie sicher sind geschützte Kreuzungen?
- Die Bordsteinkante – ein Sorgenkind?
- Sichere Gestaltung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum
- Effiziente Verkehrseinrichtungen für die barrierefreie Absicherung spezieller Baustellenbereiche und Arbeitsmittel
© Mobilfuchs, 10.04.2021, aktualisiert am 19.11.2022
Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie kostenlos die wertvolle Liste „Checkliste zur Sturzprohylaxe“.